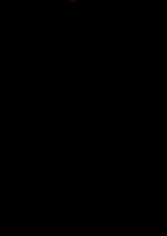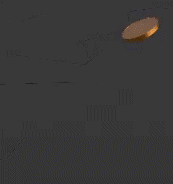
auf welche Seite eine Münze fällt?
| wann entscheidet es sich, |
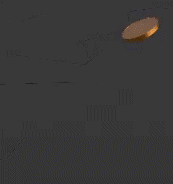 |
|
auf welche Seite eine Münze fällt? |
Vgl. auch
 ,
wo probeweise u.a. der Zufall als Antrieb des Münzwurfs angenommen wird. ,
wo probeweise u.a. der Zufall als Antrieb des Münzwurfs angenommen wird. |
Vorweg:
(Zumindest ich habe es noch nie erlebt, dass eine Münze auf ihrer Kante stehen blieb.)
|
Unten werde ich (und das nur in Einzelfällen) die beiden Münzseiten allerdings nur noch mit einem grünen und einen roten Kreis markieren. |
|
|
Schauen wir uns nun also das Fallen einer Münze genauer an:
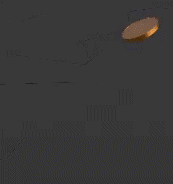
Der Gesamtprozess lässt sich unterteilen in
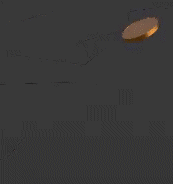 ,
,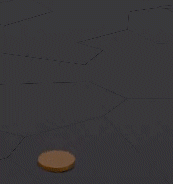 .
. Die Frage "wann entscheidet sich, auf welche Seite eine Münze fällt?"
Nun mag einer "Entscheidung" ein langer Prozess der "Entscheidungs"findung vorausgegangen sein, aber üblicherweise stellen wir uns unter einer Entscheidung ein punktuelles Ereignis vor.
("Ich habe schon seit Anfang Dezember überlegt, ob ich nach Hamburg fahren soll, aber am Samstag, dem 10.2.2024, habe ich mich um 17.42 h endgültig dagegen entschieden.")
Wie so oft bei der Verwendung von Alltagssprache in mathematischen Überlegungen, so wird auch hier durch das Wort "Entscheidung" eine Sichtweise eröffnet,
Wird die "Entscheidung" wirklich
Vor allem aber sind wir gewohnt, Entscheidungen nur Menschen
(und anderen Tieren; aber nicht Pflanzen?)
zuzutrauen, womit sich die Frage stellt, ob das Wort "Entscheidung" den Fall einer Münze unzulässig vermenschlicht, indem z.B. der Münze Gedanken unterstellt werden. Wenn aber die Münze keine Entscheidungen fällen kann, wer fällt sie dann?:
(die in den westlichen Wissenschaften ja auch nicht vermenschlicht werden dürfen)
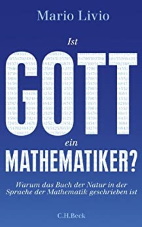 ?
?Ganz ähnlich steht es (!?) mit dem Satzteil "wann entscheidet es [!?] sich" in der Überschrift: von knappen Ausrufen abgesehen ("Oh!", "scheiße!", "au" ...), bestehen Aussagen in indogermanischen Sprachen aus Sätzen, und ein Satz enthält mindestens ein Subjekt (= Täter, Verursacher) und ein Prädikat (= Tätigkeit?).
(Dahinter steckt also die Kausalität "Ursache → Wirkung".
Wie zweifelhaft das ist, wird schön an "es regnet" deutlich
[wenn's auch kaum jemand mehr bemerkt]:
wer ist da das Subjekt "es", d.h. wer tut da das Regnen bzw. den Regen? Am ehesten ist "es" wohl noch eine Regenwolke, aber man kann dennoch nicht "die Wolke regnet" sagen
[wohl aber "eine Wolke regnet (das einzig mögliche Objekt:) sich aus"],
denn unter "Regen" versteht man üblicherweise in
sehr großer Zahl frei fallende Tropfen zwischen Wolke und Erde

[obwohl es auch innerhalb von Wolken regnet].)
Würfel: