lasset uns diskutieren
(... denn solange wir diskutieren, sind wir nicht tot)
| | "Besser Blabla als Bummbumm."
(Winston Churchill) Wenn ich mich recht entsinne, bestand ein Großteil des Religionsunterrichts in meiner Schulzeit (bevor ich genau deswegen das Fach Religion abgewählt habe) daraus, dass wir diskutieren mussten, ob schwule katholische Priester eine Frau heiraten, ein Kind zeugen und es dann abtreiben dürften. |
Der Vorwurf, Diskussionen "an sich" seien nichts anderes als Blabla, ist modisch
(obwohl doch überall auf Teufel komm raus "getalkt" wird)
und fast schon demokratieverachtend. Er taucht beispielsweise öfters als Klischee über "die 68er" auf, die
-
angeblich andauernd nur diskutiert und demonstriert,
-
aber
-
im besten Falle nichts "getan",
-
im schlechtesten Fall Kinder antiautoritär erzogen (mit ihnen diskutiert!) und damit verdorben haben.
(Schlimmer noch als jene 68er, die inzwischen auf dem "Marsch durch die Institutionen" längst ihre Ideale verraten haben
[nicht zu verwechseln mit Meinungsänderungen!],
sind jene aus der 68er-Generation, die bereits damals reaktionär gestrickt waren und sich heute nurmehr feist bestätigt fühlen)
Es bleibt vielmehr darauf zu bestehen:
"Die Fähigkeit, seine Meinung frei und öffentlich zu vertreten [und zu diskutieren!], sollte in freiheitlichen Gesellschaften zu den grundlegenden Fähigkeiten jedes und jeder Einzelnen gehören." - und muss damit geradezu Pflichtbestand des Schulunterrichts sein.
(zitiert nach  )
)
Ich hatte das Zitat schon um "und zu diskutieren" ergänzt, d.h.,
(aber das scheint oftmals unbekannt zu sein)
-
es reicht nicht, einfach nur seine eigene Meinung zu vertreten (anderen um den Kopf zu hauen),
-
sondern es ist wenn schon nicht ein Grundrecht, so doch eine wichtige Grundfertigkeit, die eigene Meinung mit anderen Menschen zu verhandeln, also
-
andere überzeugen >(statt überreden oder überrumpeln) zu können (und wollen!),
-
- und das scheint oftmals vollends unbekannt zu sein - die eigene Meinung an anderen Meinungen zu messen und ggf. auch (von Anfang an!) bereit zu sein, die eigene Meinung aufgrund zusätzlicher bzw. besserer "gegnerischer" Argumente zu modifizieren oder gar vollständig zu ändern,
d.h. also, die fremden Meinungen und Argumente auch als Chance anzusehen.
(Ich warte bislang vergebens z.B. auf einen Politiker, der in einer Talkshow plötzlich innehält und beispielsweise sagt: "Daran hatte ich noch gar nicht gedacht - und deshalb ändere oder revidiere ich meine Meinung."
Nebenbei: wo sind denn die Diskussionsthemen, die mich bereichern würden und bei denen ich das "Risiko" einer Meinungsänderung eingehen möchte? Denn LehrerInnen "lassen" doch allzu gerne diskutieren, wie sie ja sowieso SchülerInneN allzu gerne methodischen Schnickschnack vorsetzen, den sie selbst rundweg als kindisch ablehnen würden.)
Mit der (bis hier) häufigen Verwendung des Wortes "Meinung" schält sich aber schon ein - auch im Schulunterricht oftmals auftretendes - Problem heraus, nämlich
"zu allem ne Meinung, aber von nix ne Ahnung".
-
gerade weil man zu einem bestimmten Thema schon eine vorweg festbetonierte Meinung hat, gibt es (scheinbar) gar keinen Anlass mehr, sie mit "Ahnung" (also Hintergrundswissen) zu begründen ... und entsprechend fruchtlos sind dann die Diskussionen: man redet aneinander vorbei bzw. "schlägt" nur aufeinander ein - und alle gehen aus der Diskussion vielleicht verärgert heraus, ansonsten aber, als hätte die Diskussion gar nicht stattgefunden (womit sie von Anfang an überflüssig war);
-
umgekehrt fehlt es (u.a. SchülerInneN) oftmals an jedem Hintergrundwissen, und somit können sie auch nur Meinungen vortragen, statt Argumente zu liefern.
Ein entscheidendes Problem im Unterricht ist ja, dass SchülerInnen oftmals das Hintergrundwissen (die fachliche "Fülle") noch gar nicht haben können, um wirklich fundiert mitzureden, und dementsprechend unbefriedigend müssen viele Diskussionen dann auch bleiben.
Um das fehlende Hintergrundwissen bereit zu stellen, werden oftmals vor der Diskussion im "normalen" Unterricht viele Argumente gesammelt, was aber schon als langweilig empfunden wird, und wenn´s gut geht, werden hinterher in einer Unterrichtsdiskussion diese Argumente nur brav-gelangweilt abgewickelt.
Ein echter Fehler ist es meistens, (vordergründig) "jugendnahe" Themen zu verhandeln:
-
entweder sind sich sowieso alle einig,
-
oder es prallen wegen einseitig festgefahrener Meinungen (pro und conta "Tokyo Hotel" [eine Popgruppe]) nur unversöhnliche Meinungen aufeinander
(mal ganz abgesehen davon, dass solche Jugendthemen die alten Säcke [LehrerInneN] auch gar nichts angehen).
Es ist halt ungemein schwierig, Diskussionsthemen zu finden,
-
die für die Jugendlichen interessant sind
(oder - vielleicht erst auf diesem Umweg möglich - interessant gemacht werden können),
-
bei denen die Jugendlichen zu Meinungsänderungen (oder zumindest zum Überzeugen) ehrlich bereit sind,
-
bei denen ihnen Hintergrundwissen erstrebenswert erscheint,
-
bei denen nicht sowieso schon alle derselben Meinung sind.
SchülerInnen "argumentieren" oftmals einfach "aus dem hohlen Bauch" bzw. ihrer ganz subjektiven Sicht heraus.
Ein Beispiel: bei einer Kurzumfrage (nicht Diskussion) in einer meiner Klassen waren 26 SchülerInnen rabiat gegen die Ganztagsschule und war nur einer für sie.
Warum war also ein Großteil der SchülerInnen gegen das, was viele Bildungsfachleute für dringend geboten halten?
Könnte es daran liegen,
-
dass wir an unserer Schule fast nur SchülerInnen aus sogenannten "besseren" (?) Familie haben, also SchülerInnen mit einem reichhaltigen und bereichernden Freizeitangebot?
-
dass sie also nicht im mindesten wissen, wie sehr andere SchülerInnen in ihrer Freizeit allein gelassen werden und verwahrlosen?
-
dass sie sich unter "Ganztagsschule" nur eine Vermehrung des üblichen Unterrichts, also des sowieso schon als langweilig Empfundenen vorstellen können, also kein erfüllenderes Gegenmodell kennen
(das auch in der öffentlichen Diskussion zu diesem Thema kaum eine Rolle spielt)?
PS: Ich bin dennoch gegen die Regel-Ganztagsschule, und sowieso wird meiner Meinung nach mit der Ganztagsschule das Problem oftmals nur verschoben (den Schulen aufgehalst).
Natürlich gibt es hübsch kontrovers behandelbare Themen wie beispielsweise "Todesstrafe" oder "Abtreibung"
(wobei dahingestellt sei, ob sie "jugendnah" sind),
die schon allein deshalb extrem sind, weil es nunmal keine halben Toten (Zombies?) gibt.
Aber gerade diese Themen verführen zu Einseitigkeiten
-
durch die Lehrkraft selbst, die beispielsweise
und jeden, der dennoch für sie ist, mehr oder minder merklich moralisch abkanzelt
(warum lässt die Lehrkraft solche Themen dann überhaupt diskutieren?).
-
, weil die Diskussionsteilnehmer komplette gegnerische "Bereiche" nicht zu akzeptieren bereit oder fähig sind: beispielsweise
-
ein Todesstrafengegner nicht die Verzweiflung und Wut von Angehörigen eines Mordopfers;
-
ein Abtreibungsbefürworter nicht die einschlägigen Fotos ermordeter (!?) Embryos, mit denen die Abtreibungsgegner oftmals "Reklame" machen,
-
ein Abtreibungsgegner nicht, wie extrem schwer sich ausnahmslos alle Frauen, die ich kenne und sich zu einer Abtreibung entschlossen haben, sich diese Entscheidung gemacht haben.
Aber genauso drastisch muss solch ein Thema "auf den Tisch" kommen - und dennoch darf es nicht bei der primären emotionalen Wirkung bleiben.
Am Beispiel der Todesstrafe:
-
über die Todesstrafe darf nicht mitreden, wer sich nicht vorstellen kann, dass ein naher Verwandter oder guter Freund ermordet wurde;
-
über die Todesstrafe darf nicht mitreden, wer sich nicht vorstellen kann, dass ein naher Verwandter oder guter Freund (oder gar er selbst) zum Mörder wird;
-
bei der Todesstrafe ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen
-
der direkten (höchst verständlichen und legitimen!) Emotionalität von Angehörigen,
-
und der Chance Außenstehender (des Staates), trotzdem (und doch in vollem Wissen um 1.!) distanziert zu handeln und mehrere Aspekte
(z.B. - horribile dictu - die Vorgeschichte des Mörders oder rechtsstaatliche Grundsätze wie die Resozialisation, aber auch die Möglichkeit von Fehlurteilen)
im Auge zu behalten.
Wo in Diskussionen wird mal deutlich, dass es eine Alternative
(Vgl. etwa, dass
-
die SPD vor der Bundestagswahl 2005 gegen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer war,
-
die CDU vor derselben Bundestagswahl für eine 2-&-ige Erhöhung der Mehrwertsteuer war
-
und man nach der Wahl den Mittelwert mit 3 [!] berechnet hat.)
Die Alternative besteht laut Hegel darin, dass aus These und Antithese eine Synthese entwickelt wird, die eben nicht nur ein fauler Kompromiss bzw. Mittelwert ist - und sein kann
("ab sofort wird jeder Mörder nur halb hingerichtet bzw. nur jeder zweite Mörder hingerichtet").
Vielmehr haben bei einer Synthese (auf Diskussionen bezogen) die Kontrahenten voneinander gelernt und entwickeln eine "überlegene", vorher (ohne Diskussion) gar nicht mögliche Lösung.
Zwei Beispielversuche:
-
In einem (nicht "meinem") Lehrerkollegium gab es bitteren Streit darüber, dass der Rauch aus dem Raucher-Lehrerzimmer
(als sowas noch erlaubt war!)
durch einen dazwischenliegenden Verbindungsraum immer in das Nichtraucher-Lehrerzimmer rüber zog.
Die These war da:
"Liebe Nichtraucher, stellt euch nicht so an, und so schlimm ist das doch gar nicht."
Die Antithese lautete:
"Dieser rüberziehende Dunst stört mich aber eben doch gewaltig, und deshalb plädiere ich für die komplette Abschaffung des Raucherlehrerzimmers."
Die (dann prompt von allen akzeptierten) Synthese des Schulleiters lautete aber:
"Wir montieren an die beiden Verbindungstüren automatische Türschließer."
(Nunja, vielleicht war die Synthese nicht der Weisheit letzter Schluss, denn bei dieser "Lösung" wird noch immer der Rauch vom Raucherzimmer erst [wenn auch verkürzt] in den Verbindungsraum und dann nochmals [wiederum verkürzt] in das Nichtraucherzimmer wehen.)
-
Bei der Todesstrafe könnte die Synthese darin bestehen, dass man sie zwar verboten lässt, aber - was viele phantasielose Todesstrafengegener allzu leicht übersehen - doch erheblich mehr den Opfern (hier den Angehörigen von Mordopfern) hilft.
Solche Synthesen müssen aber überhaupt erst mal vorgemacht und als attraktiv erlebt werden!
Bzw. es muss - ganz im Sinne solcher Projekte wie "fair streiten" - klar werden, dass Streiten nicht an sich negativ ist, sondern
| Es müsste (wie?) vorgemacht und vor allem wirklich erlebt werden, dass der argumentative und rhetorische "Kampf der Giganten" höchst lustvoll ist, ja, dass auch der geistige Kampf attraktiv und sogar erstrebenswert ist (und sei es als Möglichkeit der Abfuhr für körperliche Gewalt). Und es müsste (was hier allerdings arg abstrakt bleibt) erlebt werden, dass der argumentativ-rhetorische Kampf tatsächlich weiter bringt, also nicht (immer) allein auf der sprachlichen Ebene bleibt, sondern auch neue Einstellungen ermöglicht, ja sogar "performativ" wird, also zu neuen Handlungen führen kann. (Neben der Verbohrtheit ist der Eindruck am schlimmsten, am Ende einer Diskussion sei alles "totdiskutiert", habe man für alles und jedes [flaues] "Verständnis" und sei jede Entscheidungsmöglichkeit abhanden gekommen. Ein Beispiel gegen alle Unentschlossenheit und allzu leichtfertiges "die Gesellschaft ist schuld" (wobei ich allerdings "jeder Einzelne ist schuld" noch viel schlimmer finde): Wie kommt es, dass der Bruder Mikal des berühmten Mörders  Gary Gillmore dieselbe Sozialisation genossen hat - und dennoch einen "sozialverträglicheren" Weg gegangen ist?) Gary Gillmore dieselbe Sozialisation genossen hat - und dennoch einen "sozialverträglicheren" Weg gegangen ist?) |
"Sexy" wird das Thema "Diskussionen" für SchülerInnen sowieso erst, wenn
(vielleicht mit dem Hintersinn, dass SchülerInnen sowas nicht tun sollen; und doch ist mir das wieder zu moralinsauer);
(und doch ändert das "Plätten" - wie das meiste Kabarett - oft leider nichts;
und überhaupt muss man ja nicht immer gleich zum allzu probaten Faschismus-Knüppel greifen
["Nun gibt es in
der Tat Leute, die, wenn ihnen nichts mehr einfällt, gleich »Auschwitz!«
röcheln.
Man kennt das trübe Spielchen zur Genüge: Wer als erster
»Faschist!«
ruft, hat gewonnen."
(Wiglaf Droste; Quelle:
 )]:
)]:
vermutlich verbietet sich wirklich der Vergleich zwischen Faschismus einerseits und Privatfernsehen/Mediokratie andererseits, aber das Privatfernsehen ist doch allemal stumpf und überflüssig genug, um mächtig rhetorisch drauf rumzuhacken);
Dazu muss man aber erst mal an gegebenen Beispielen die Fülle der Möglichkeiten erkennen.
Zwei Beispiele:
-
 Zwar ist das vielleicht schon viel zu "hoch", aber es hat doch zwei entscheidende Vorteile:
Zwar ist das vielleicht schon viel zu "hoch", aber es hat doch zwei entscheidende Vorteile:
-
liegt es dokumentiert (wenn auch leider nur als Transkripte, also schriftlich, und einige wenige reine Ton-Ausschnitte), nämlich auf einer DVD vor,
-
wird im "Literarischen Quartett" deutlich, dass auch "gehobene Leute" lustvoll streiten
(wenn auch in einer Art, die mir am "Literarischen Quartett" nie gefiel, ja all meiner Vorstellung von Literaturkritik radikal widerspricht; kommt hinzu, dass ich die Teilnehmer großteils nicht für "gehoben" hielt),
dass also Streiten auch in feinsten Schichten "legitim" ist.
-
bessere unter den jeweils aktuellen Talkshows
(also nicht all die Nachmittagsbeichten ["ich habe meinen Hund gefickt"] oder "Sabine Christiansen"; und sowieso inkl. Talkshowkritik).
Eine andere Möglichkeit ist, was sogenannte "Debattierclubs" vormachen:
-
"Debattieren bedeutet nicht diskutieren. In einer Debatte wird nicht nach einem Konsens gesucht, sondern die Argumente der beiden Seiten prallen kompromisslos aufeinander. Aufgabe des Debattierers ist es, seine Argumente inhaltlich wie rhetorisch gegen die der gegnerischen Seite zu behaupten."
(zitiert nach  )
)
Zwar widerspricht das geradezu meinen Vorstellungen von "Diskussion" (will es ja auch gar keine Diskussion sein), aber solche Pro-Contra-Gefechte schulen natürlich ungemein den Geist, und sei´s, um
-
die Argumente des Gegners vorauszuahnen und also auch besser parieren zu können,
-
diese "gegnerischen" Argumente aber auch in die eigene Sichtweise einzubeziehen.
Anders gesagt: systematisches (fiktives) Dagegen-Sein macht intelligent (und schön!) - und macht allzu leicht zynisch.
-
In diesen Debattierclubs bekommt man nicht die "Meinung" zu vertreten, die man sowieso schon hat, sondern wird einem "Pro" oder "Contra" per Zufall zugeteilt, d.h. man ist ggf. gezwungen, sich in die gegnerische Meinung hinein zu versetzen und sie überzeugend vorzutragen.
-
Zur Entlastung von allzu viel (oft moralinsaurem) Tiefsinn, aber auch von Voreingenommenheiten gibt es oftmals auch regelrechte "Nonsens-Themen" wie z.B.
-
"Die Fußballnationalmannschaft soll basisdemokratisch gewählt werden",
-
"Alkoholverbot für Studenten",
-
"Zwangszeugung für deutsche Ehepaare"
(ist das wirklich nur ein Nonsens-Thema oder nicht doch der Beigeschmack vieler familienpolitischer Diskussionen?)
Vielleicht verhilft all das auch ein wenig zu gehöriger Selbstironie und Bescheidenheit
(dass man sich selbst samt eigener Meinung nicht allzu ernst nimmt),
macht aber auch allzu leicht zynisch.
SchülerInnen sollten auch ein Gespür bekommen für eine Rhetorik,
(oder ihn gar raffiniert-ironisch konterkariert),
-
einfach nur hübsch raffiniert ist,
-
abgründig wirkt (z.B. viele rhetorische Fragen),
-
oder nur noch artifiziell leerläuft.
Kein Zweifel, man muss auch
(langatmig und frustrierend, aber eben unvermeidbar)
das "Handwerkszeug" lernen, also beispielsweise
(was bei vielen SchülerInnen keineswegs so selbstverständlich ist),
wie man Argumente, wenn man sie denn erst mal gefunden hat, sortiert und aufeinander bezieht.
Da kann (ausnahmsweise) eine "Mindmap", die wirklich
durchaus hilfreich sein.
Selbstverständlich kann man immer prächtig in den (angeblichen) "Blabla-Fächern" (Deutsch, Erziehungs- und Sozialwissenschaften sowie natürlich Religion) diskutieren ... aber doch nicht in Naturwissenschaften oder Mathematik!
Ich bin der festen Überzeugung, dass das auch dort geht - und nötig ist (vgl. 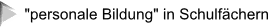 ).
).
Mehr noch: ich halte den Eindruck für fatal
(auch für diese Fächer selbst!),
dass es in Mathematik
(außer bei "Kurvendiskussionen", die kaum diesen Namen verdienen)
und den Naturwissenschaften grundsätzlich nichts zu diskutieren, sondern nur zu erlernende endgültige Wahrheiten gebe.
![]() )
) Zwar ist das vielleicht schon viel zu "hoch", aber es hat doch zwei entscheidende Vorteile:
Zwar ist das vielleicht schon viel zu "hoch", aber es hat doch zwei entscheidende Vorteile: