Themenwahl
Wenn, wie oben gesagt, die Lehrkraft besonders in der Lage sein sollte, vorauszuahnen (und sich doch immer wieder zu irren), wie SchülerInnen vermutlich denken, so ist das beste Ausgangsthema eines, bei dem sie selbst noch ansatzweise Schwierigkeiten hat und auf der Suche ist - also Stochastik, und zwar
-
, weil die an Schulen erst seit Kurzem verpflichtend und daher auch für die meisten LehrerInnen neu ist;
-
, weil sie - insbesondere in der Interpretation - auch Profis noch ganz enorme Stolperfallen bietet (vgl. etwa das Ziegenproblem  ).
).
Aus diesem Grunde sei hier als Anlass das Stochastikteilgebiet "Hypothesentests" gewählt.
Das technische Hilfsmittel dabei sei "Inspiration", das
-
zwar bislang nur englischsprachig vorliegt
(ein gewisser Nachteil im Unterricht; die Bedienung erfolgt allerdings weitgehend über Symbole),
-
noch nicht sehr verbreitet ist,
-
meiner Meinung nach aber gewisse Vorteile ggb. ähnlichen Programmen hat.
Allerdings hat "MindManager" den Vorteil, dass es für Schulen aus NRW kostenlos erhältlich ist. Vgl. 
Vorausgesetzt sei im Folgenden etwas fast Utopisches: dass man in all dem gängigen  Stoffdruck mal wirklich Zeit hat. Nun, immerhin wird man sich ja vielleicht phasenweise mal Zeit nehmen können
Stoffdruck mal wirklich Zeit hat. Nun, immerhin wird man sich ja vielleicht phasenweise mal Zeit nehmen können
( 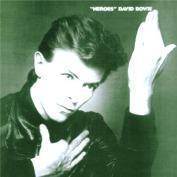 "We could steal time - just for one day").
"We could steal time - just for one day").
Es erscheint zwar fraglich, ob man jemals so viel Zeit investieren kann, wie das in der unten geplanten Unterrichtseinheit angedacht wird. Aber wenn man von gleich welcher Aufgabe sofort zur Mathematik übergeht, diskreditiert das diese Aufgabe nur sofort als "eingekleidete" Mathematik. Da sei man ehrlicher und lasse sie gleich ganz weg.
Im Folgenden kann aufgrund der gebotenen Kürze(?) nur ansatzweise versucht werden, sich den typischen Problemen zu stellen: wie
-
sich aus einem Chaos eine Struktur ergibt, ohne dass diese von Anfang an allzu fest ist und SchülerInnen nur noch nachvollziehen "dürfen",
-
aus einem offenen Anwendungsproblem die Mathematik überhaupt erst langsam entstehen kann (Modellierungsprozess)
(was allerdings letztlich immer fiktiv bleibt, weil ja alles im Mathematikunterricht [d.h. auch nach eindeutigem Vorunterricht] stattfindet),
-
den SchülerInnen durch geeignete Materialvorgaben Leitlinien zur Verfügung gestellt werden können, an denen sie sich "festhalten" oder orientieren können
(so dass sie sich nicht im Chaos allein gelassen fühlen, sich aber auch nicht - wie doch meist üblich - nur auf vorgegebenen, weichenfreien Gleisen bewegen können und unselbstständig gehalten werden),
-
dem Mathematisierungs- sowie innermathematischen Prozess umgegangen werden kann, d.h. welche hilfreichen Anregungen gegeben werden können und müssen.
geeignete Aufgaben (allgemein)
Als erstes ist nach einem geeigneten Anwendungsbeispiel zu suchen. "Geeignet" heißt dabei
-
rein von der Mathematik aus gedacht
(denn wir sind und bleiben zu allererst MathematikerInnen und müssen auch zu gewissen mathematischen Grundkenntnissen hinführen!):
-
muss die Aufgabe zu gewissen mathematischen Inhalten (hier Hypothesentests sowie Fehler 1. und 2. Art) hinführen,
-
muss sie mathematisch ergiebig sein;
-
als "Zwischending" zwischen Mathematik einerseits und Anwendung andererseits:
die Aufgabe muss exemplarisch für den Prozess der Mathematisierung geeignet sein, d.h.
-
offen anfangen,
-
eine Mathematisierung erlauben, ja wünschbar erscheinen lassen,
-
zu innermathematisch und in Folge davon auch auf die Anwendung bezogen aussagekräftigen Ergebnissen führen,
-
am besten aber auch noch andere als nur mathematische Vorgehensweisen und Lösungsansätze zulassen, so dass die Mathematik als ein (unverzichtbares!) Instrument in einem ganzen Orchester dasteht;
-
rein von der Anwendung bzw. dem Thema aus gedacht (also noch vor aller Mathematik bzw. unabhängig von ihr) "interessant" und ergiebig sein.
konkrete Aufgabenauswahl und Begründung
Durchaus geeignet scheint mir da die Aufgabe in Anlehnung an
| Raphael Diepgen: | Signifikanz - Na und? Politik und Computer im Statistikunterricht in: mathematiklehren 13/1985 S. 54ff |
| Gerhard Schröder und Edmund Stoiber möchten möglichst früh am Wahlabend (am besten noch vor den Interviews in den verschiedenen Hauptnachrichtensendungen) wissen, ob ihre jeweiligen Koalitionen die Wahl gewonnen haben. |
Nebenbei: die weitere Erklärungen bei Diepgen, also
"[...] d.h. vereinfacht mehr als 50 % der Wählerstimmen [...] Er beauftragt daher ein Wahlforschungsinstitut, am Wahltag eine Zufallsstichprobe von 1000 Wählern unmittelbar nach der Stimmabgabe über ihr Wahlverhalten zu befragen. Konzipieren Sie als Leiter des Forschungsinstitut das Verfahren - in Absprache mit Herrn D. natürlich -, wie am Wahlabend aufgrund der Befragung entschieden werden kann."
würde ich aus mehreren Gründen selbstverständlich weg lassen:
-
ist die Prozentangabe eine fast schon für dumm verkaufende Banalität, bzw. die ja in der Tat vorhandenen Probleme (z.B. auch Überhangsmandate), wann eine Wahl gewonnen ist, können die SchülerInnen ja selbst herausfinden;
-
wird mit "vereinfacht" ein gewichtiger Teil des Mathematisierungsprozesses schon anfänglich amputiert (vgl. auch "Zufallsstichprobe von 1000 Wählern");
-
brauchts kein extra zu beauftragenden Wahlforschungsinstitute, da diese ja sowieso schon im Umfeld der Wahl arbeiten - und sich damit nur die Frage stellt: wie?
-
ist die Ernennung der SchülerInnen zu "Leiter(n) des Forschungsinstituts" schon nachgerade anbiedernd, weil völlig unrealistisch? Ich zweifle damit also mal an der Überzeugungskraft von Rollenspielen;
-
: warum eigentlich eine ausdrückliche Aufgabe (meist Frage) statt erst mal der reine Sachverhalt?
-
: was soll eigentlich "in Absprache mit Herrn D."?
-
und umgekehrt: warum (heute noch) ein ominöser "Herr D."
(bei Diepgen ein "Regierender Bürgermeister" und - wie ein Foto klar macht - ironischerweise der mit demselben Namen),
wenns doch erheblich spannendere und vor allem immer aktuelle Wahlen gibt?
Die Aufgabe scheint mir im Sinne aller drei o.g. Kriterien sinnvoll zu sein:
zu 3., also der (vormathematischen) Interessantheit:
Sicherlich kann hier nicht - wie so oft bei vermeintlichen Anwendungsaufgaben vorgegeben wird - von direkter "Lebensnähe" gesprochen werden:
-
"Politikersorgen sind ganz und gar nicht meine Sorgen, und wenn überhaupt, so interessiert mich nur das Wahlendergebnis, d.h. die faktische Machtsituation im Land."
-
Viele SchülerInnen sind vermutlich reichlich desinteressiert an Politik
(eine Diskussion über die Gründe und Berechtigung solch einer Haltung und darüber, obs überhaupt einen Unterschied macht, ob Schröber oder Stroider regiert, gehört ja durchaus zum Thema dazu
["wenn Wahlen etwas verändern würden, wären sie längst verboten"],
darf aber weder in simpler "Politikverdrossenheit" und Pauschalverurteilung von Politikern [das Parlament als "Quatschbude" und "Selbstversorgungsladen"] noch in einem moralischen Wahl- und Politikzwang enden, erlaubt hingegen durchaus eine Parteienkritik; vgl. etwa 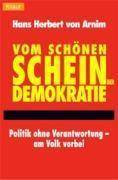
Ideal wäre also ein Gemeinschaftsprojekt zusammen mit dem Fach Sozialwissenschaften).
Dennoch kann vielleicht eine indirekte Lebensnähe erreicht werden:
-
"Wieso [zudem oftmals grob falsche] Wahlhochrechnungen mit irrwitzigem Computeraufwand? Man warte doch einfach bis zum amtlichen Endergebnis. Schließlich ist Politik kein Spiel!?"
-
"Wieso Wettervorhersage? Wenn ich wissen will, wie das Wetter heute ist, schaue ich heute aus dem Fenster, und wenn ich wissen will, wie es morgen ist, schaue ich morgen aus dem Fenster."
-
"Was »haben« die Opfer eines Flugzeugabsturzes in Südamerika und was »habe« ich davon, wenn ich von diesem Flugzeugabsturz erfahre? Was daran ist die Nachricht, nach der man [wer?] sich richten kann?"
-
Die zentrale (herauszuarbeitende) Frage hinter der Aufgabe ist doch, warum es überhaupt wichtig ist, wann der Kanzlerkandidat vor die Kamera tritt, und welche Konsequenzen es haben kann, wenn die Hochrechnung, auf die er sich dabei verlässt, falsch ist:
-
Möglichkeit: der Kandidat hält sich fälschlich für den Sieger - und protzt los, dass er das schon immer gewusst habe und er ja sowieso der bessere sei; im für ihn selbst später schlimmsten Fall fällt er sogar über den vermeintlichen Verlierer her;
-
Möglichkeit: er hält sich fälschlich für den Verlierer - und ergeht sich in vornehmer Demut ("»der« Wähler hat gesprochen, und das werde ich als guter Demokrat natürlich respektieren").
Hier nun kommt etwas (scheinbar) völlig Unmathematisches, nämlich "Psychologisches" ins Spiel: die erste Möglichkeit ist doch wohl erheblich peinlicher, ja politisch "tödlicher" als die zweite - und das muss natürlich auch in die Strategie des Politikers am Wahlabend eingehen. Vgl. Diepgen:
"Herr D. möchte [...] auf jeden Fall vermeiden, sich voreilig in den Interviews am Wahlabend als Wahlsieger zu geben, falls er tatsächlich die Wahl verloren hat. Dann sei es ihm schon lieber, sich fälschlicherweise als Wahlverlierer zu geben, obwohl auch dieses nicht gerade imagepflegend sei."
Diese Peinlichkeit scheint mir aber durchaus schüler- bzw. lebensnah, seis, dass man sie niemandem gönnt, seis, dass man einem gewissen Politiker solch eine Blamage durchaus gönnt, damit er endgültig von der politischen Bühne verschwindet (nicht mal mehr Oppositionsführer wird).
Nun ist es zwar immer gefährlich, mit Peinlichkeiten zu spielen (weil sie schnell was Beschämendes haben), aber die Peinlichkeit solch eines Politikers werden die SchülerInnen in Analogie selbst kennen, ja, dass man das Verhalten eines anderen als peinlich empfindet, beruht wohl vor allem darauf, dass man sich selbst in seine Lage versetzt.
(eine aktuelle Ergänzung
[die allerdings naturgemäß nicht lange aktuell und interessant bleiben wird]:
 23.9.02:
23.9.02:
"[...] Unions-Kanzlerkandidat Edmund Stoiber (CSU) erklärte sich als erster zum Wahlsieger, als festzustehen schien, dass die Union mehr Stimmen als die SPD errungen hatte. Wenig später sagte Schröder vor seinen jubelnden Anhängern, schon mancher habe sich zu früh gefreut. [...]"
In der Bundestagswahl am 22.9.2002 ist also leicht abgewandelt o.g. Szenario eingetreten: nie zuvor war ein Wahlabend so spannend
[wenns überhaupt einen Unterschied gemacht hat, wer da an die Macht kam]:
der Wahlausgang war derart knapp, dass die Prognosen und ersten Hochrechnungen der drei großen Sender ARD, ZDF und RTL zwei völlig unterschiedliche Koalitionen bzw. eine Pattsituation anzeigten, und erst spät in der Nacht [und überhaupt erst durch sogenannte Überhangsmandate] trat Klarheit ein, dass wohl doch die alte Rot-Grün-Regierung bestätigt worden war.
Nun sind die Ergebnisse allerdings zwiespältig:
-
zwar wurde Rot-Grün mit einer hauchdünnen Stimmenmehrheit von bundesweit nur 8864 Stimmen bestätigt, musste aber doch insgesamt Stimmenverluste hinnehmen;
-
die CDU hatte einen Stimmenzuwachs [hat sich also - immerhin! - von der Schlappe 1998 erholt], kam aber dennoch nicht an die Macht, weil ihr potentieller Koalitionspartner FDP zwar auch einen leichten Stimmenzuwachs hatte, aber mit 7,4 % der Stimmen doch blamabel hinter dem groß herausposaunten Ziel von 18 % blieb:
"mit 17 hat man noch Träume"
-
in unserem Zusammenhang wirklich interessant war aber das ansonsten wohl eher nebensächliche Detail, welche Partei stärkste Fraktion wurde, also das beste Einzelergebnis erzielte und nebenbei auch traditionsgemäß den Bundestagspräsidenten stellen würde: am relativ frühen Wahlabend, als noch lange nicht klar war, welche Regierungskoalition gewählt worden war, feierte die CDU immerhin schon (als Trost bzw. Zwischenziel?), dass sie die größte Fraktion stellen würde - und musste sich in der Nacht eines Besseren belehren lassen.
EDMUND STOIBER
„Wir haben die Wahl gewonnen!“
„Wir, CDU und CSU, wir haben die Wahl gewonnen“, sagte Unionskanzlerkandidat Edmund Stoiber und hielt beide Daumen nach oben. In den nicht enden wollenden Jubel der „Edmund, Edmund-Rufer“ fügte Stoiber hinzu: „Ich danke allen, die „mit uns gearbeitet und gekämpft haben“, besonders jedoch Angela Merkel und Laurenz Meyer. "CDU und CSU - die große Partei der politischen Mitte ist wieder da".
(zitiert nach  , Montag, der 23.September 2002 06:45:08 Uhr )
, Montag, der 23.September 2002 06:45:08 Uhr )
Und jetzt [23.9.2002, morgens] frage ich mich, ob der Bundeswahlleiter nicht doch Nachzählungen anordnen und dann alles doch noch mal kippen wird.)
-
"Punkt 18 Uhr stehen die Sieger und Verlierer einer Wahl so gut wie fest, meist auch die Koalitionsmöglichkeiten. Häufig sind es lediglich die Fünf-Prozent-Hürde und damit die üblichen Wackelkandidaten, die eine gewisse Spannung am Wahlabend bis über 20 Uhr hinaus erhalten."
"Der Wahlforschung ist es also auf der Grundlage von Umfrageergebnissen durchaus möglich, realistische Prognosen über den Wahlausgang abzugeben. Mehr Klarheit bringt jedoch die Befragung am Wahltag, und mit der ersten Hochrechnung steht das Ergebnis meistens schon fest."
(zitiert nach
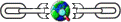 )
)
D.h. aber doch, dass die Kandidaten in der Regel schon um 18 Uhr genau wissen, woran sie sind, und o.g. Überlegungen, wann sie vor die Kamera treten sollen, obsolet bzw. völlig fiktiv sind.
-
ist die eigentlich interessante Frage doch, wie es die Wahlforscher schaffen, derart exakte frühe Ergebnisse zu liefern. Dazu aber sind sowohl mathematisch als auch sozialwissenschaftlich und politologisch derart komplexe Verfahren nötig, die in der Schule sowohl vom fachlichen als auch vom technischen Aufwand schlicht utopisch sind.
Daraus aber kann nur folgen, dass man mit den SchülerInnen dieses Problem (wenn sie es selbst entdecken!) offen bespricht und den Blick umlenkt, und zwar darauf
-
, dass es nur um einfachste Modellrechnungen gehen kann,
-
, dass die komplexeren Hintergründe zwar nicht genau erarbeitet, aber eben doch interessant sein können,
-
, dass die o.g. Dramatik, obwohl fiktiv, eben doch interessant ist.
(Aber letztlich ist die Aufgabe ja nur ein Anlass, um im Hinblick auf den Einsatz von Mindmaps mal exemplarisch konkret zu werden.)
zu 2., also der Stufe zwischen Mathematik und Anwendung:
Gerade in der verkürzten Fassung ist die Aufgabenstellung sehr offen und noch gar nicht eindeutig mathematisch. Dennoch führt sie über den Umweg der wohl notwendigen Hochrechnungen auf mathematisches Gebiet, bleibt aber - etwa mit der Peinlichkeit - keineswegs nur in diesem.
zu 1., also dem rein innermathematischen Gehalt:
Auf dem Umweg über Hochrechnungen führt die Aufgabe direkt in die Hypothesentests und bietet - viel wichtiger - mit der Peinlichkeit ein besonders eindrückliches Beispiel für die sogenannten Fehler erster und zweiter Art.
In den allermeisten sonstigen Beispielen sind diese beiden Fehler leicht miteinander zu verwechseln
(und sowieso kann ich mir nie die Reihenfolge merken),
weil sie letztlich "emotionslos" bleiben oder aber, wie gerade das klassische Standardbeispiel zeigt, geradezu austauschbar sind: keine Ahnung, ob ich aufgrund einer "falschen" Statistik lieber
-
ein neues, gefährlicheres Medikament einnehme (Fehler 1. Art),
-
ein neues, besseres Medikament nicht einnehme
(Fehler 2. Art).
Beide Fehler können nämlich gleichermaßen tödlich sein, während im o.g. Politikerbeispiel - wie gezeigt - die eine Alternative erheblich weniger peinlich ist als die andere.
Vor allem aber scheint mir das Thema, wenn man es so aufzieht, wie ich es unten vorschlage, exemplarisch geeignet für den Einsatz von Mindmaps, um die es hier ja wohl vor allem geht.
Insgesamt ist mit der vorliegenden Aufgabe die Gefahr wohl zumindest teilweise eingeschränkt zu sein, die Diepgen an anderer Stelle selbst beschrieben hat:
"[...] daß es zumindest auf »offene« Aufgaben zum Hypothesentesten häufig keine unstrittigen Lösungen gibt. Nur Aufgaben, die schon sehr viel vorgeben und im Grunde nur noch die numerische Ausarbeitung eines bestimmten Tests verlangen, dürften eindeutig lösbar sein, sind dafür aber auch nicht so reizvoll und anregend für den Unterricht [...]"
(aus: Mathematik; Aufgabenstellen im Stochastikunterricht; ausgearbeitet von W. Schuster; Heft Grundlegende Gesichtspunkte AS 3; Deutsches Institut für Fernstudien an der Universität Tübingen; Arbeitsbereich Mathematik/Informatik; darin S. 134)
Allerdings muss im Folgenden darauf geachtet werden, dass
-
der Einstieg tatsächlich so offen wie nur irgend möglich (aber eben doch nicht beliebig) ist,
-
die Vereinfachung (z.B. 1000er-Stichprobe) problematisiert wird,
-
am Ende eine Rückübersetzung stattfindet.
zurück zu 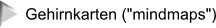
![]() ).
).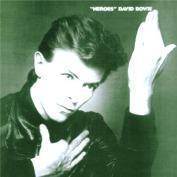 "We could steal time - just for one day").
"We could steal time - just for one day").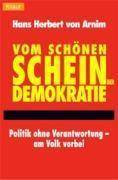
 23.9.02:
23.9.02: